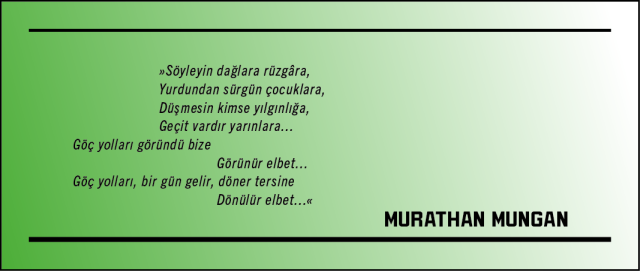
Can Dündars Theater Kolumne #51
CAN DÜNDAR’IN TİYATRO SÜTUNU
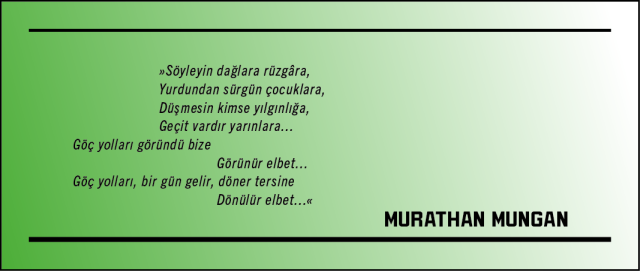
Köşe yazısının Türkçe orijinal metni için tıklayınız.
#51 Das Berlin der Vertriebenen
Der große Schriftsteller Yaşar Kemal begann seine literarische Laufbahn mit Reportagen – er interviewte Fischer, Bauern, Schmuggler, Mittellose. Er selbst erzählte einmal: »Nach einem langen Interview las ich einem Mann, dessen Geschichte ich aufgezeichnet hatte, später den fertigen Text vor. Der Mann weinte und sagte: Mensch, was man uns alles angetan hat …«
Manchmal kann das, was man selbst erlebt hat, unwirklich erscheinen, wenn es von jemand anderem in Worte gefasst wird. So fühlten auch wir uns, als wir bei Hayko Bağdats Solo-Performance am Maxim Gorki Theater einen Ausschnitt aus unserem gemeinsamen Exilleben sahen: »Mensch, was wir alles erlebt haben …«, dachten wir. Unsere Auswanderung nach Berlin, die ersten Tage in einer fremden Stadt, in der wir weder bekannt waren noch jemanden kannten, unser Ringen um Halt, die Angst, nicht verstanden zu werden, unsere großen Träume, kleinen Probleme, unsere Enttäuschungen. Wir waren viele, und wir waren einsam.
Das erinnerte mich an Volker Weidermanns Ostende: 1936 Sommer der Freundschaft. Auch wir hatten die dunklen Wolken am Horizont unseres Landes gesehen. Unsere Bücher wurden verboten, wir wurden strafverfolgt, entlassen, überwacht, bedroht. Einige von uns verließen die Heimat gezwungenermaßen, andere freiwillig. Berlin öffnete uns die Arme. Wir versuchten, den Schmerz über die Trennung von unserem Land und unseren Liebsten zu lindern – und unsere Kunst zu unserer neuen Heimat zu machen.
Weidermann beschreibt jenen Sommer »vor der Finsternis«, in dem sich eine Handvoll Exilierter an der belgischen Küste für kurze Zeit gegenseitig Halt gibt. Natürlich ist unsere Dunkelheit nicht vergleichbar mit der im Deutschland der 1930er-Jahre – und auch unser »Sommer« war ein anderer als der in Ostende. Aber auch unsere Dunkelheit dauert lange. Viel länger, als wir erwartet hatten …
Berlin ist eine Stadt der Vertriebenen. Es gibt viele, die über Jahrhunderte hinweg von hier vertrieben wurden – und viele, die von anderswo hierher getrieben wurden. In verschiedenen Epochen war Berlin Gastgeberin für unterschiedliche migrantische Gruppen. Man hört es an den Sprachen auf der Straße, sieht es auf den Schildern in den Vierteln, in der Vielfalt der Musik, des Essens – aber auch in misstrauischen Blicken oder in der der Unruhe, die rechtsextreme Parteien verbreiten. Man spürt die Flucht, die Spuren der Migration, die Vertrautheit mit dem Exil. Deshalb kann man sich hier zumindest teilweise zu Hause fühlen. Trotz des Aufschwungs migrationsfeindlicher Politik kennt Berlin den Schmerz der Vertreibung aus der eigenen Geschichte. Ein kulturelles Klima, das Unterschiede aushält, eine Gesellschaft, die Vielfalt als Reichtum begreift, Menschen, die Schutzsuchende mit offenen Armen empfangen. Das alles macht Berlin für Vertriebene lebenswert.
Fast neun Jahre lebe ich nun in Berlin. Und ich sehe all jene, die nach mir kamen: Syrer*innen, Afghan*innen, Ukrainer*innen, Palästinenser*innen – sie kamen eine*r nach dem*der anderen, auf der Flucht vor den Brandherden in verschiedenen Teilen der Welt. Der Berliner Hauptbahnhof hörte das müde »Ach!« und die hoffnungsvollen Gebete auf Arabisch, Kurdisch, Paschtu, Farsi, Ukrainisch … Wie die Schichten eines alten Bodens haben wir uns übereinandergelegt – in die Wohnungen einer verwundeten, kriegsgeprüften Stadt.
Wir erzählten einander von dem Kummer, den wir mitgebracht hatten – und er wurde weniger, je mehr wir ihn teilten. Die, die früher kamen, gaben ihr Wissen weiter:
Wie man mit Behörden klarkommt, zu welchem Arzt man geht, wo man günstig wohnen kann, wie man schnell Deutsch lernt, wie man einen Asylstatus bekommt. »Hast du einen Kita-Platz für dein Kind gefunden?« »Hast du deinen Führerschein gemacht?« »Wie läuft dein Deutschkurs?« »Hast du schon den Antrag auf Staatsbürgerschaft gestellt?«
Jede*r, der oder die kam, lernte von denen davor. Sie wie jene erschufen ihre eigenen, alternativen Berlins in den versteckten Winkeln der Stadt, fügten ihre eigenen Farben zu den Farben der Stadt hinzu. Diese Vielfalt macht die Stadt wohl zu einem Kaleidoskop aus Schmerz und Freude, Angst und Hoffnung, Fremdheit und Vertrautheit, Heimweh und Ankommen.
»Was man uns alles angetan hat …«. Auch die Menschen aus der Türkei haben sich schichtweise in die Geschichte dieser Stadt eingeschrieben: Die ersten kamen in den 1960er-Jahren, auf der Suche nach Wohlstand. Sie wollten nur kurz bleiben, genug Geld verdienen, um sich in der Heimat ein Haus zu kaufen – doch es kam anders. Sie holten ihre Familien nach oder gründeten hier neue. Sie schlugen Wurzeln in diese Stadt hinein. Wurden Wohnungseigentümer*innen, gaben Berlin ihre neuen Generationen. Sie veränderten die Stadt – und die Stadt veränderte sie. Manche kehrten in Särgen zurück, die müden Körper anderer wurden hier beerdigt.
Später brachte jeder Putsch eine neue Generation von Vertriebenen: Nach dem Militärputsch vom 12. März 1971 kamen viele. Dann die Geflüchteten nach dem 12. September 1980. Und die Überlebenden der Massaker der 1970er- und 1990er-Jahre.
Wir sind die »Erdoğan-Vertriebenen« der letzten zehn Jahre. Wir kamen nicht, weil wir eines Morgens mit militärischer Marschmusik aus dem Bett geholt wurden. Auch nicht, weil fanatische Islamisten unser Zuhause anzündeten, Faschisten unsere Städte in Brand setzten oder Mörder Andersgläubige töteten. Wir haben uns aus anderen Gründen auf den Weg nach Berlin gemacht. Wir flohen vor einer Tyrannei, die sich nicht plötzlich, sondern schleichend, nicht laut, sondern systematisch ausbreitete. Und je mehr sie an Macht gewann, desto dreister wurde sie. Wir flohen vor einer Autokratie, die uns Stück für Stück die Luft zum Atmen nahm. Manche von uns kamen freiwillig, andere gezwungenermaßen. Manche, weil sie nicht mehr unzensiert schreiben konnten. Andere, weil sie sich auf der Straße nicht mehr sicher fühlten. Manche, weil sie befürchten mussten, dass eines Morgens die Polizei an ihre Tür klopft. Wir kamen mit der Hoffnung, endlich frei schreiben zu können, frei gehen zu können und zu wissen: Wenn es an der Tür klingelt, ist es kein Einsatzkommando.
Haben wir gefunden, wonach wir suchten? Jede*r würde das anders beantworten.
Manche hielten dem Verlust, der Trennung, dem Schmerz der Fremde nicht stand; sie gaben auf und gingen zurück. Aber viele fanden auch Halt.
Einige von uns stehen heute wie Hayko Bağdat auf der Bühne und erzählen ihre Geschichte. Andere schreiben – wie ich – über das, was unser Land durchmacht. Einige machen Musik, Theater oder Filme, in denen sie die Erfahrungen verarbeiten. Andere malen sie und stellen sie aus. Manche forschen, unterrichten, berichten oder gehen in die Politik – sie alle versuchen, ihre Stimme hörbar zu machen: in Berlin und darüber hinaus. Jede neue Stimme fügt sich ein in den vielstimmigen Klang dieser Stadt. Je größer die Repression in der Heimat, desto größer unsere Zahl, desto lauter unser Chor.
Und plötzlich hat ein neuer Buchladen aufgemacht – mit Büchern, die unsere Geschichten erzählen. Oder eine neue Kneipe, in der die Lieder gesungen werden, die unseren Schmerz besingen. Dort begegnen wir einander. Dort lesen wir Gedichte von jenen Dichter*innen, die den Schmerz des Exils kennen:
»Sagt es den Bergen, dem Wind
den Kindern, die aus der Heimat vertrieben
Verliert nicht den Mut
Es führt ein Weg in die Morgen…
Die Pfade des Exils sind vor uns
Gewiss, das sind sie…
Die Pfade des Exils, eines Tages kehren sie um
Und auch wir kehren heim…«
(Murathan Mungan)
Mit einem Ohr horchen wir immer auf die gute Nachricht in unserer Muttersprache, wartend, während wir gleichzeitig versuchen, die neue Sprache zu lernen, die Eigenheiten dieser Stadt zu begreifen, uns in sie hineinzuschreiben – mit Gedichten, Liedern, Büchern oder Dissertationen. Berlin verändert sich mit uns, während wir uns mit ihr verändern.